|
Dies ist die 2. Seite
vom neu eröffneten 7.III.Selbstbau-Projekt.
11.03.2024
Aufbau und Löten der Platine
Alle Bauteile waren bereits auf der Stückliste der 1.
Seite enthalten.
(mit Ausnahme der Platine)
Die neue, ungelötete Roh-Platine
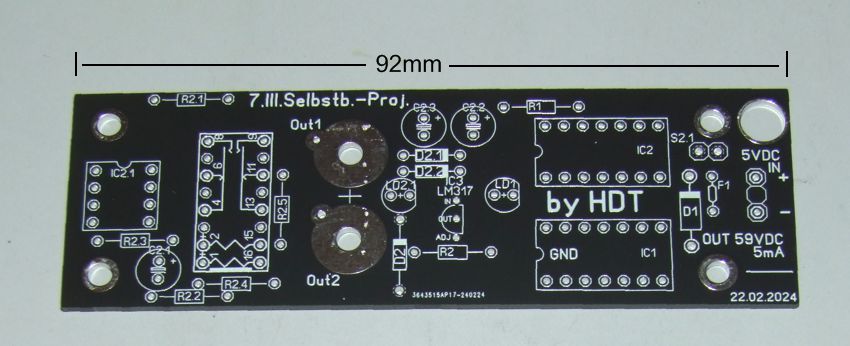
Bild 1
Empfehlung zum Einbau des Relais und der DC-Wandler, sowie des Timer-ICs
Werden diese Teile von Anfang an fest verlötet, sind sie später für die Verwendung
auf anderen Platinen kaum noch zu "Entlöten". Besonders der Anfänger wird aber möglicherweise eine
Platine mehrmals neu aufbauen müssen, wegen einem großen Fehler oder Defekt der Lötaugen
oder Leiterbahnen. (durch mehrfaches Löten an Lötaugen, entstehen Ablösungen der
Kupferfläche)
Für diesen Fall ist es sehr von Vorteil, wenn man die
genannten Bauteile nicht direkt fest verlötet, sondern "steckbar" verbaut und dazu IC-Sockel oder
Fassungen verwendet, in denenn die Bauteile
wiederverwendbar bleiben. Dazu verwendet man "IC-Fassungen
mit gedrehten Buchsen", die kosten ein paar Cent mehr, halten aber die Bauteile
sehr gut an ihrem Platz.
Die neue Platine mit IC-Fassungen
versehen
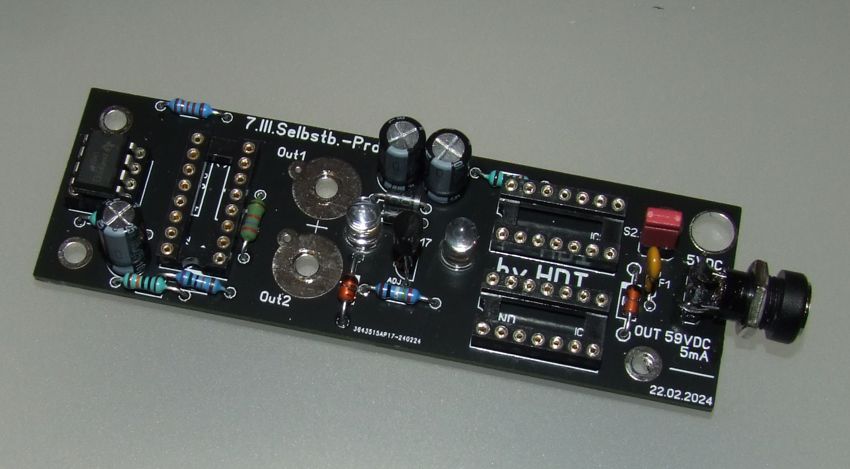
Die neue fertig gelötete Platine mit den DC-Wandlern und dem Relais
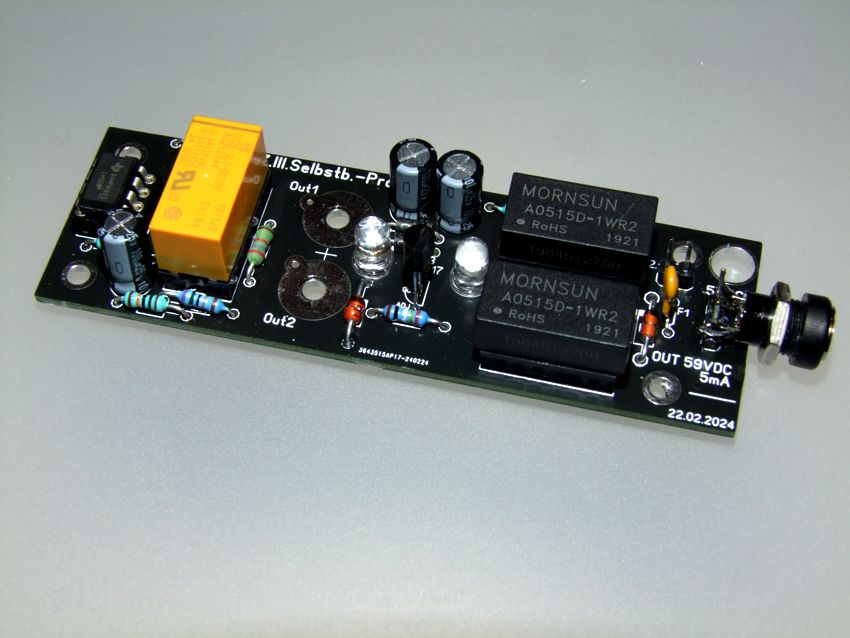
Das neue
Gehäuse gebohrt mit den Montageteilen

Zwei verschiedene Einbauvarianten für das gleiche Gehäuse.
Der
Unterschied ist gering. Links die Variante mit außen liegenden
Elektrodenanschlüssen. Rechts die Variante mit innen liegenden
Elektrodenanschlüssen.

Die Unterseite der beiden Einbauvarianten.

Das wichtigste Dokument neben dem Schaltplan ist der Bestückungsplan.
Der neue
Bestückungsplan

Der neue Bestückungsplan nochmals vereinfacht dargestellt
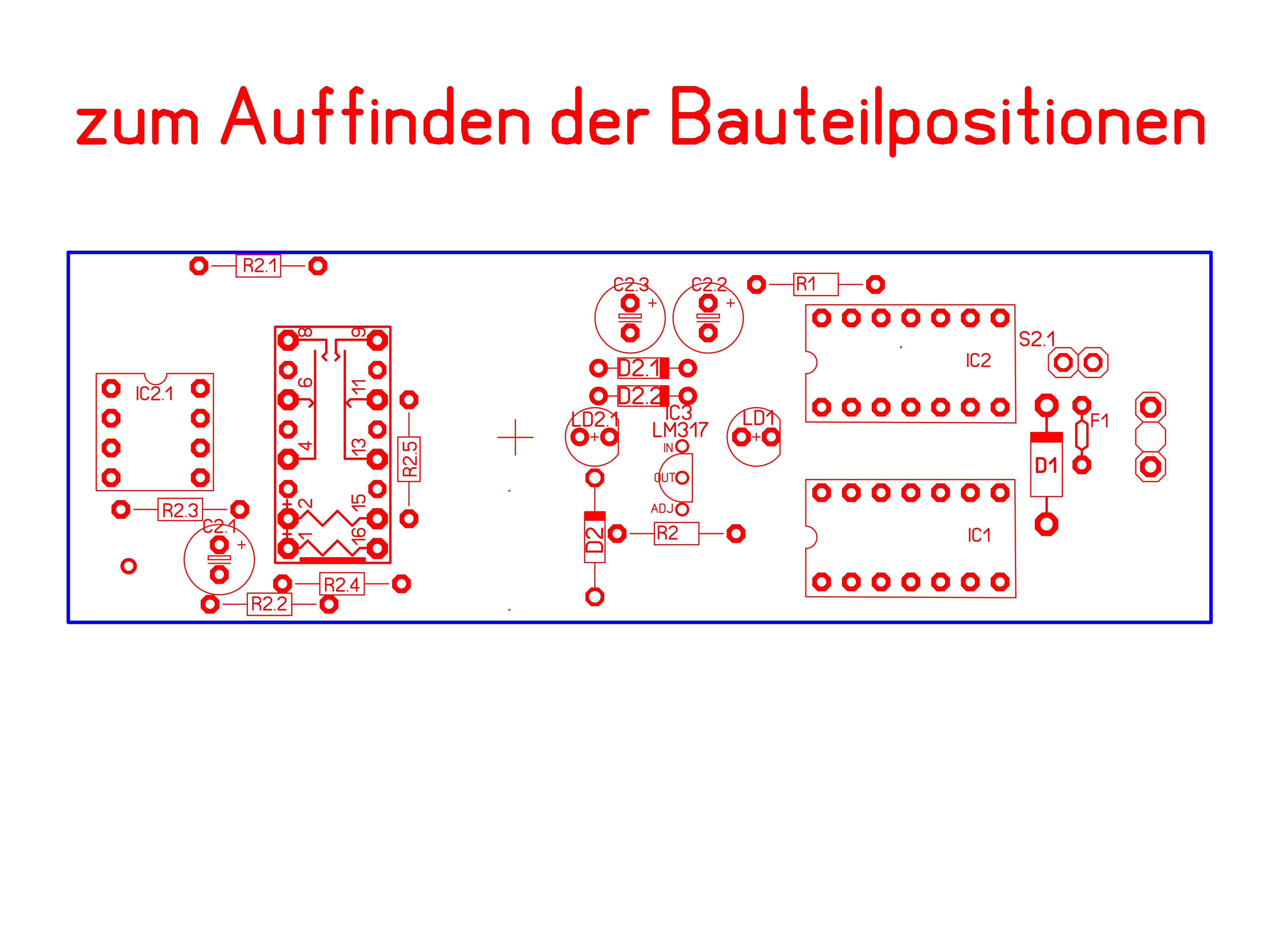
Man ´beginnt die Bestückungs- und Lötarbeiten am besten mit den flachen
Bauteilen, Den Widerständen.
Danach weiter mit den Dioden und den Fassungen
für Timer-IC, DC-Wandler und Relais. Zum Schluss die Elkos.
* * *

Impressum:
©
April/2005 by HANS-DIETER TEUTEBERG • hans-dieter.teuteberg@t-online.de
Illustrationen
© H.D.T.
|

